„Mich interessieren die Schäden, die das System in unserer Seele anrichtet“, sagt die engagierte türkische Journalistin und Autorin Pınar Öğünç. Im ersten Lockdown 2020 ließ sie Menschen vor allem aus dem „prekären Milieu“* in einer Interview-Serie im Own-Story-Format eindringlich zu Wort kommen. Lebensbilder vom System gebeutelter „kleiner Leute“, „denen schon als Kind klar war, dass das Leben ihnen keine Chancen zu bieten hat“, zeichnet sie auch in ihrem zweiten Erzählband Beterotu (Schlimmerkraut, 2019). Ihre Held:innen bemühen sich, aus der Monotonie des Alltags auszubrechen und einen Zipfel vom Glück zu erhaschen. Manchen gelingt das mit wunderbarer Phantasie, andere strampeln sich vergeblich ab, einige verrennen sich fürchterlich …
Sein halbes Leben lang sammelt der pensionierte Büroangestellte Enver Hulki Bey heimlich Zettel vom Boden auf und lässt anhand der Notizen seine Fantasie spielen. Mitunter greift er auch tätig ein, führt Telefonate, ändert Termine. „Wenn er den Verlauf eines fremden Lebens veränderte, und sei es boshaft, freute er sich diebisch. Dann fühlte er sich lebendig.“ Sein Leben lang sucht er nach einem Zettel, der sein Leben verändert – vergeblich. (Hususi hayat / Privatleben)
Die junge Dessous-Verkäuferin Filiz bandelt scheu mit einem Imbissboten an, beide träumen von Liebe und Freiheit. Davon träumt aber auch die in engen Grenzen gehaltene Tochter des Imbissinhabers, sie überredet den Boten, sie auf dem Moped mitzunehmen, nur ein einziges Mal. Es kommt, wie es kommen muss, Filiz’ Kollegin sieht die beiden – am Ende sind alle Bande zerstört und alle unglücklich allein. (Tanga mevsimi, karnabahar mevsimi / Tanga-Zeit, Blumenkohl-Zeit)
Eine Mittfünfzigerin zieht auf der Bank des Physiotherapeuten eine melancholische Bilanz, sinniert darüber, wie „ein Unfall den Atlas des Körpers verändert“, wie „große Veränderungen stets kleine Auslöser haben“, und fragt sich, wie es sein kann, dass Menschen dieselben Ereignisse völlig unterschiedlich erinnern. (Ağrı eşiği / Die Schmerzschwelle)
Auf einer langen Busfahrt liegt der Blick eines Mannes gedankenverloren auf dem Handy eines Jugendlichen in der Reihe vor ihm, der Fotos und Videos sichtet, zum Unmut der Mitreisenden ohne Kopfhörer. Plötzlich flackert ein Feuer über das Display. Der Mann schreckt auf: das ist ein Video vom Anschlag auf sein Geschäft! Er stellt den Jugendlichen zur Rede, der streitet ab, in der Klopause eskaliert der Streit. (Neyin tek sahibisiniz lan? – Was gehört nur Ihnen, Mann?)
Eine Art Wimmelbild mit einem unergründlichen Alarm als Auslöser für aufgeschreckte Menschen in einer Straße irgendwo in einem Istanbuler Viertel zeichnet Ses – Tuval üzerine yağlıboya (Ton – Öl auf Leinwand). Mit wenigen Strichen skizziert die Autorin die Charaktere all der Leute, die jeder täglich sieht, ohne sie wirklich „zu sehen“:
Ein Immobilienmakler, der sich in vermeintlich attraktiven Posen ablichten lässt und die Fotos auf Instagram stellt. Er ist stolz darauf, gleich im ersten Semester als Spitzel angeworben worden zu sein. Die Entlassung, zum Teil Verhaftung mehrerer Studierenden und Professoren geht auf sein Konto …
Eine Brautmoden-Verkäuferin hat sich zweimal gegen die Familie durchgesetzt, einmal als sie mit 22 heiraten wollte, dann um sich mit 25 scheiden zu lassen. Sie ist stolz auf ihre Courage und meint, nichts im Leben könnte sie noch aus der Bahn werfen. „Doch warum bin ich dann nicht glücklich?“, fragt sie sich mit 29 „mit der Wut ihrer Rechte Beraubter“.
Zwei Dachdecker aus dem Osten beobachten einen übers Dach flüchtenden mutmaßlichen Dieb. Stürzt er ab, wovon sie ausgehen, so amateurhaft wie er sich bewegt, wollen sie sich seiner Tasche bemächtigen, mutmaßen, welch einen Schatz sie wohl birgt.
Ein „Gemälde“ – und doch ist dies die einzige Geschichte, in der unablässig Aufregung und hektische Bewegung herrscht.
Malen tut auch Saliha Hanım, die alte Dame, deren größte Sorge angesichts fortschreitender Demenz ist, ihre alte Holzvilla nicht zu vergessen. Diese war 1983 abgerissen und durch einen größeren Bau ersetzt worden, der vor drei Jahren seinerseits einem sechsstöckigen Haus mit 10 Appartements weichen musste, um Platz für die weitere Familie zu schaffen. Ein Abbild der regen Tätigkeit des Bausektors, auf dem Erdoğans Wirtschaft fußt. Ein Klempner lässt eine Bemerkung fallen, daraufhin entdeckt eine neue Mieterin ein beklemmendes Geheimnis: beim Bau verunglückte ein Bauarbeiter, der nun irgendwo im Haus einbetoniert liegt, denn der Unfall wurde vertuscht, Zeugen mit Geld zum Schweigen gebracht. Die alte Saliha aber malt weltvergessen Blumen … Eine rasant und einfallsreich geschriebene Studie über moderne Menschen in einem Haus, mit einem „Arbeitsverbrechen“ im Zentrum, wie derartige Unfälle aus fahrlässiger Unterlassung von Kritiker:innen in der Türkei genannt werden, die sich in den letzten Jahren häufen. (Çimento – Zement)
Als sich ein Handy an einer Dolmuş-Haltestelle eigenmächtig in ein Wlan-Netz einwählt, bricht Erinnerung an eine verflossene Beziehung auf. Ağ tercihleri (Netzpräferenzen) ist ein Stück darüber, wie soziale Medien unser Leben bestimmen können. Darin findet sich die zauberhafte Beschreibung, wie eine nie offiziell beendete Beziehung im Sande verläuft:
Wie ein Lied im Radio sanft, immer leiser ausklingt, verblassten wir im Leben des jeweils anderen mehr und mehr, blieben noch eine Weile darin, bis wir ganz verschwanden und in jeweils andere Lieder übergingen.
Und dann ist da „Ein Schritt vor und zwei zurück“ (Bir ileri iki geri): Am Ende graben zwei erwachsene Männer heimlich nachts an der Autobahn am Fuß der Schlafstadt nach einem „Schatz“. Darin sehen sie die einzige „Chance“ in einem Leben, das für sie keine Chancen parat hält. Ihre Söhne hatten dort beim Spielen „antike Gegenstände“ gefunden. Ayla erklärt ihren Mann Ender für verrückt, als er ernsthaft hofft, dort wertvolle Schätze vertriebener Armenier zu finden. Er aber beginnt, neben seinem Job als Chauffeur bei der Stadt auszuloten, was für ihn drin sein könnte. Es ist der hilflose Versuch, aus einem öden, von Sozialneid und Fernsehen erfüllten Leben, das schon mit Anfang 30 trostlos ist, auszubrechen. Die Familie lebt seit dem Abriss ihres Gecekondus isoliert in einer der zuhauf am Stadtrand errichteten Schlafstädte. Ender verteufelt Alkohol und verbietet seiner Frau, im nahen Einkaufszentrum zu arbeiten. Wofür er den Baseballschläger im Auto benutzt, verschweigt er ihr wohlweislich.
Im Kofferraum lag ein Baseballschläger aus Buchsbaum mit der Gravur „Schmerzstiller :)“. Seinerzeit war ihm die Auswahl zwischen „Hier kriegst du Türkenkraft zu spüren“, „Bildung muss sein :)“ und „Osmanische Ohrfeige“ schwer gefallen. Natürlich hatte er den Schläger nicht bei einem Baseball-Ausstatter gekauft, ein solches Geschäft gab es in der Stadt gar nicht.
Mir steht Erdoğans Drohung während der Gezi-Proteste 2013 vor Augen: „Unsere 50 Prozent halte ich nur mit Mühe im Haus.“ Sprich: seine Unterstützer stünden bereit, gegen die für Demokratie Demonstrierenden loszuschlagen. Ja, Ender, der Held dieser Geschichte, ist einer der Wähler/Unterstützer der Trumps und Erdoğans unserer Tage. Und nicht allein er, in der ersten Erzählung war da der Imbissinhaber, der mühsam seinen kleinen Familienbetrieb in Gang hielt, die ambitionierte Tochter von der Schule nahm und in die Imbissküche steckte. Die Eltern sind keine schlechten Menschen, sie wollen nur das Beste für die Tochter, sind aber gefangen in den Konventionen und Moralvorstellungen ihres kleinen beengten Lebens. Auch sie typische Vertreter der frommen Basis, auf die Erdoğans AKP wie auch diverse andere konservative Parteien sich stützen.
Am besten gefiel mir die Geschichte einer wundervollen Bürobekanntschaft (Plazada huzur / Frieden im Büroturm): „Auf deinem Rücken ist Afrika zu sehen“, sagt ein ihr bis dahin unbekannter Mitarbeiter zur Ich-Erzählerin, als sie, verschwitzt, daher der Landkartenfleck auf der Bluse, morgens die Sneaker gegen High Heels tauscht. Bald führt er sie an ungewöhnliche, schöne Plätze im Gebäude und drum herum, lässt sie in den Mittagspausen an seinen kleinen Fluchten aus dem grauen Alltag teilhaben: ein verwunschener Garten hinter Mauern, ein in einem Fenster gebrochenen Regenbogen-Lichtstrahl, ein verlassener Kopierraum … Über Privates reden sie nie. Seine Frage: „Wollen wir zusammen eine Fremdsprache lernen, ohne dass jemand davon erfährt?“, nimmt sie als die schönste Liebeserklärung der Welt, auch wenn die Idee nur Gedanke bleibt. Dann bricht die Realität in ihr kleines Paradies, als sie Unterschriften für die Anpassung der Raumtemperatur sammelt, er aber lieber weiter schöne kleine Dinge sucht und den Status Quo hinnimmt. „Schönes aus dem jämmerlichen Zustand der Welt

herauszupicken, schien wie die Verschiebung unseres Wunsches nach Korrektur all des Hässlichen.“ Ein Plädoyer für Achtsamkeit im Alltag wie auch ein Anstoß, sich eine wichtige gesellschaftspolitische Frage zu stellen: Engagieren wir uns, um zu ändern, was uns stört, oder arrangieren wir uns damit?
Im letzten Text begleitet Ceylan, die sich gegen den Willen der Eltern an der Universität einschrieb, den Vater, der zum Abbruch bestimmte Gebäude ausschlachtet und Verwertbares weiterverkauft, ins heimatliche Dorf. Denn die eigensinnige, vorwitzige, ob ihres Humors beliebte Tochter hat eingesehen, dass sie Kâmuran nicht länger in der Wohnung halten kann, in einem Karton hinten im Lieferwagen wird er nun ins Dorf verfrachtet: ein kleines Wildschweinferkel, das ihr zulief, als seine Rotte vom Straßenbau am Waldrand aufgescheucht wurde. Die liebevolle Vater-Tochter-Beziehung ist zweifellos die schönste Beziehung in diesem Buch, Ceylan kommt mir wie ein pfiffiges Alter Ego der Autorin vor. (Ceylan ile Kâmuran)
Pınar Öğünç, 1975 in Istanbul geboren, studierte Politik und ist seit 1997 als Reporterin und Journalistin tätig, u.a. für die Zeitungen Radikal, Cumhuriyet, Gazete Duvar. 2008 wurde sie vom türkischen Journalistenverband für das beste Interview („Wer sind die Steine werfenden Kinder?“) ausgezeichnet. Einige Artikel und Essays erschienen u.a. auf taz.gazete auch auf Deutsch. Neben Dokumentar- und Kurzfilmprojekten arbeitet sie auch weiter literarisch.
Auf einen Schlag könne sich alles ändern, das lehre uns die Geschichte, möglich sei dies mit Menschen, die es wollen, sagt Öğünç im Interview. Hoffnung haben und handeln, statt sich passiv mit „Es gibt Schlimmeres“ einzurichten, lautet ihre Devise und das ihrer Protagonist:innen. Sie bewundert Menschen, die trotz aller Enttäuschungen nie den Wunsch aufgeben, ihr Leben zu verändern. Von ihnen erzählt sie hier in zehn fein gezeichneten Lebenswelten aus dem heutigen Istanbul, die Geschichten machen Mut und wirken nach.
Pınar Öğünç: Beterotu [Schlimmerkraut]. Istanbul: İletişim Yayınları, 2019.
*Der Begriff aus der SINUS-Studie für Deutschland lässt sich natürlich nur bedingt auf die türkische Gesellschaft übertragen.
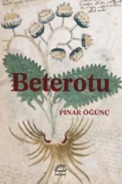

Hinterlasse einen Kommentar